Wohnung. Eine Ansammlung von Kinderspielzeug. Dazwischen die letzten verbliebenen Erinnerungsstücke an eine kinderlose Zeit. Gut verstaut und in Sicherheit. Und dann, plötzlich, packt mich der Putzwahn. Von Zeit zu Zeit stehe ich in der Wohnung und habe einen Blick von außen. Als ob ich da gar nicht wohnen würde. Und ich erschrecke.
„Langweilig, mir ist so langweilig“, erwähnt Kind 2 samstags gelangweilt. Nach weiteren Selbstgesprächen, in denen es über die nächste Aktivität entscheidet, schmettert mir ein „Darf ich putzen?“ entgegen. Minuten später stehen wir mit feuchtem Wischtuch, Staubsauger und anderen Utensilien bewaffnet im Kinderzimmer. Uninteressant, wenn man zuerst alle blockierenden Möbel aus dem Weg räumt. So deute ich zumindest den Blick von Kind 2.
Einsatz.
Mit Wischtuch krabbelt Kind 2 auf allen Vieren in die letzten Winkel des Zimmers. Meiner Einschätzung nach lohnen sich Kinder tatsächlich. Kein Winkel zu eng, keine Wollmaus sicher. Die kleinen Hände erwischen noch eine kleine, sich auf der Flucht befindlichen Spinne.
Mit einem „Sauber“ verabschiedet sich die kleine Menschenkehrputzmaschine. Was sich so vorteilhaft und reibungslos liest, bleibt diesmal an mir hängen. Die Feinarbeit. Dazu muss ich anfügen, dass ich eher der Mensch fürs Grobe bin. Staubsaugen? Klappt. Couch wegschieben und darunter staubsaugen fällt hingegen unter Feinarbeit. Außerdem besetzt Kind 2 die Couch schon wieder. Keine Chance.
Im Kinderzimmer wische ich kurz die restlichen Ecken, um anschließend das Finale einzuläuten: Staubsaugen. Fertig. Kein Hexenwerk. Kind 2 kontrolliert meine Arbeit und bestätigt mit einem anerkennenden „So können wir das lassen, Papa. Das reicht jetzt.“ meine Tätigkeit. Überhaupt ist es wichtig. Also die Bestätigung. So geben Kinder einem doch das Gefühl, dass 5 Minuten Wischen und Putzen tatsächlich völlig ausreichend für ihr Wohlbefinden sind.
„Was machst du mit all den Spielsachen hier?“ pfeift es aus Kind 2 heraus. Vor einem Tisch stehend bestaunt es Spielsachen, die wir gemeinsam beim Putzen aus den letzten Winkeln des Zimmers herausgefischt haben. Mir schiesst ein „Das kommt alles weg“ durch den Kopf, was aber gleich durch ein pädagogisches Meisterwerk abgelöst wird, wie nur ich es mir ausdenken kann.
„Kinderzimmer-Flohmarkt! Kinderzimmer-Flohmarkt! Alle Kinder, die noch einige ihrer Spielsachen benötigen, können diese jetzt bei mir kaufen. Zu extrem günstigen Preisen. Ist ja Flohmarkt. Handeln erlaubt. Was nicht verkauft wird, wandert in eine Tüte.“

Foto: Joachim S. Müller / CC BY-NC-SA 2.0
Kind 1 und 2 betreten ungläubig das Kinderzimmer. Ein „Mit echtem Geld?“ Duett wird vorgetragen. Ja sehe ich denn aus, als ob Kinderzimmer-Flohmarkt ein Spiel wäre? Beide Kinder holen ihre Geldbeutel. Der Verkauf startet. Unglaublich, für was Kinder alles Geld zu zahlen bereit sind. Kind 1 kauft ein drei Monate altes eigenes Gemälde, ein paar Autos und das gesammelte Loom Bänder Werk. Kind 2 sichert sich das gebastelte Holz-Schwert, den Glitzer-Nagellack, irgendein gebrochenes Lego-Teil und einiges mehr. Während dem Verkauf lernen wir, wie wichtig es ist, geschickt zu verhandeln. Die Kinder gewinnen. Die Teile gehen alle zwischen 1 und 5 Cent weg.
Der Tisch ist leer. Alles verkauft. In diesem Moment fühle ich mich so gut, wie selten zuvor. Wann bitte hat jemals ein Mensch an einem Flohmarkt wirklich alles verkauft? Ich fühle mich großartig. Fast einzigartig. Bis mir mein Ziel des Flohmarkts in den Kopf kommt. Mein pädagogisches Meisterwerk. Ursprünglich wünschte ich mir doch, dass die Kinder sich auf spielerische Art und Weise lernen von Dingen zu trennen, die total nutzlos sind. Wie interpretierbar das „Nutzlos“ ist, verstehe ich nun viel besser. Mein persönlicher Lerneffekt des Flohmarkts.
Und irgendwie fühlt es sich trotzdem gut an, alles verkauft zu haben und vor einem leeren Tisch zu stehen. Kind 1 und 2 bekommen ihr investiertes Geld natürlich zurück. Ein „Siehst du Papa, habe ich doch gewusst, dass dein Plan nicht funktioniert!“ begleitet mich zur Kaffeemaschine. Ich brauche eine Pause. So ein pädagogisches Meisterwerk ist wirklich anstrengend.
Mein Fazit nach dem Kaffee lautet: Scheitern sollte man mit Freude. Aus Überzeugung. Aus einem guten Gedanken heraus. Scheitern macht Freude und glücklich. Selbstironie inklusive. Ende.
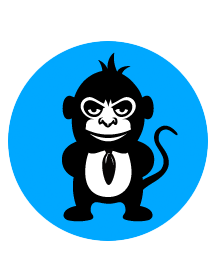
1 Kommentar
[…] Floyd von papaganda schildert uns eine amüsante Episode aus der Kindererziehung, die dann doch ganz anders läuft als geplant und erwartet. So ist das mit der Erziehung. Unvorhersehbar manchmal. http://papaganda.org/2014/09/23/scheitern-erziehen-gluecklich-scheitern/ […]
Zu faul zu tippen? Dann nutze den KOMMENTAROMAT! Klicke unten auf einen der Buttons und deine Reaktion wird eingetragen. Fülle bitte noch die Pflichtfelder "Name" und "E-Mail" aus und klicke auf Abschicken.